Wussten Sie, dass knapp 90 Prozent der Menschen in Deutschland sich nachhaltigere Unternehmen wünschen? Tatsächlich gehören bereits 42 Prozent von uns zu den «aktiv Nachhaltigkeitsbewussten», die ihren Alltag umweltfreundlicher gestalten möchten.
Allerdings zeigen die Zahlen auch, wie gross der Handlungsbedarf noch ist: Der ökologische Fussabdruck eines Europäers ist etwa sechsmal so gross wie der eines Menschen aus Bangladesch. Dabei bestimmt allein unsere Ernährung ein Drittel dieses Fussabdrucks.
Deshalb haben wir diesen praktischen Leitfaden zur Nachhaltigkeit im Alltag entwickelt. Von der Reduktion des Energieverbrauchs – der in privaten Haushalten zu 75 Prozent durch Heizung verursacht wird – bis hin zu nachhaltigen Ernährungsgewohnheiten: Wir zeigen Ihnen konkrete Wege, wie Sie Ihr Leben nachhaltig gestalten können.
Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie wir mit kleinen Veränderungen grosse Wirkung erzielen können!
Was bedeutet Nachhaltigkeit im Alltag wirklich?
Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein modisches Schlagwort – es handelt sich um ein Handlungsprinzip, das unsere Zukunft entscheidend prägt. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und beschreibt ein einfaches Prinzip: Wir sollten nur so viel Holz schlagen, wie im gleichen Zeitraum nachwächst. Doch was bedeutet dies nun konkret für unseren Alltag?
Die drei Säulen der Nachhaltigkeit verstehen
Das Drei-Säulen-Modell bildet die Grundlage für ein umfassendes Verständnis von Nachhaltigkeit. Dieses Konzept geht davon aus, dass nachhaltige Entwicklung nur durch das gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzen von umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen erreicht werden kann. Alle drei Bereiche stehen in enger Wechselwirkung und bedingen einander.
Die ökologische Säule orientiert sich am stärksten am ursprünglichen Gedanken, keinen Raubbau an der Natur zu betreiben. Sie bezieht sich darauf, die natürlichen Lebensgrundlagen nur in dem Masse zu beanspruchen, wie diese sich regenerieren können. Im Alltag bedeutet dies zum Beispiel, Energie zu sparen, Ressourcen zu schonen und Müll zu reduzieren.
Die ökonomische Säule beschreibt eine Wirtschaftsweise, die dauerhaft betrieben werden kann, ohne über unsere Verhältnisse zu leben. Dabei geht es nicht nur um Profit, sondern auch um faire Handelsbedingungen und langfristige Strategien. In unserem täglichen Leben können wir dies durch den Kauf regionaler Produkte unterstützen, wodurch wir gleichzeitig lange Transportwege und unnötige Emissionen vermeiden.
Die soziale Säule fokussiert auf die Gestaltung einer Gesellschaft, in der soziale Spannungen in Grenzen gehalten werden und Konflikte friedlich gelöst werden können. Chancengleichheit, faire Löhne und die freie Entfaltung der Persönlichkeit stehen hierbei im Mittelpunkt. Für Armut, Zwangs- und Kinderarbeit sowie Ausbeutung ist in diesem Modell kein Raum.
Dennoch wird dieses Modell auch kritisiert. Kritiker sehen in der Gleichgewichtung dieser Säulen im Grunde nur wieder den Ist-Zustand aller Dinge beschrieben und nicht etwa eine Forderung zugunsten einer nachhaltigeren Entwicklung. Trotz dieser Kritik konnte sich bislang kein anderes Modell durchsetzen, und die drei Säulen bilden nach wie vor den grössten gemeinsamen Nenner in fast allen Definitionen nachhaltiger Entwicklung.
Warum kleine Veränderungen grosse Wirkung haben
Wenn wir die aktuellen Zahlen betrachten, wird deutlich, wie dringend Handlungsbedarf besteht: Würden alle Menschen so leben wie wir in Österreich, bräuchten wir die Ressourcen von 3,7 Planeten. Beim Lebensstil der USA wären sogar fast 5 Planeten nötig. Im Vergleich dazu verbraucht ein Mensch in Indien nur Ressourcen im Umfang von 0,7 Planeten.
Allerdings bedeutet Nachhaltigkeit im Alltag nicht, dass wir unser Leben komplett umkrempeln müssen. Bereits kleine Veränderungen können in ihrer Gesamtheit einen grossen Unterschied machen. Das Prinzip der «Philosophie der kleinen Schritte» ermöglicht es uns, schrittweise nachhaltigere Gewohnheiten zu entwickeln.
Dieser Ansatz umfasst mehrere Stufen:
- Selbstbeobachtung: Indem wir unser Konsumverhalten und unsere Gewohnheiten analysieren, können wir herausfinden, wo Veränderungen am leichtesten umzusetzen sind.
- Themenwahl: Es ist sinnvoll, mit einem Bereich zu beginnen, in dem Veränderungen leichter fallen.
- Alternativen finden: Nachdem wir einen Bereich identifiziert haben, suchen wir nach nachhaltigeren Alternativen.
- Umsetzung: Wir setzen die geplante Veränderung um und machen sie zur Gewohnheit.
- Fortschritt: Ist eine Veränderung zur Routine geworden, können wir uns dem nächsten Bereich widmen.
Für eine nachhaltige Lebensweise stehen uns verschiedene Strategien zur Verfügung: Suffizienz (Verringerung des Ressourcenverbrauchs), Effizienz (ergiebigere Nutzung von Material und Energie) und Konsistenz (naturverträgliche Stoffkreisläufe).
Im Alltag können wir beispielsweise Energie sparen, indem wir Licht ausschalten, wenn wir nicht im Raum sind, oder Wasser sparen durch kürzeres Duschen. Auch beim Einkaufen können wir nachhaltige Entscheidungen treffen, indem wir Produkte bevorzugen, die lokal produziert und fair gehandelt sind.
Wichtig ist zu verstehen: Nachhaltigkeit ist kein Zustand, sondern ein Prozess, der Zeit braucht. Es geht nicht darum, perfekt zu sein oder alles richtig zu machen. Vielmehr geht es darum, im Alltag immer wieder bewusste Entscheidungen zu treffen, die nicht nur uns, sondern auch der Gemeinschaft und der Umwelt zugutekommen.
Daher gilt: Auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, so ist es trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Denn am Ende fügen sich alle grossen und kleinen Massnahmen zu etwas zusammen, das uns gemeinsam voranbringt: zur Reduktion der Klimaerwärmung, Vermeidung von Umweltverschmutzung und Schonung unserer Ressourcen.
Erste Schritte: Einfache Veränderungen mit grosser Wirkung
Nachhaltige Veränderungen im Alltag umzusetzen muss weder kompliziert noch teuer sein. Mit einfachen Anpassungen können wir bereits einen beachtlichen Unterschied machen – und das oft ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Betrachten wir zunächst drei Bereiche, in denen kleine Änderungen grosse Wirkung zeigen.
Plastikverbrauch reduzieren: Praktische Alternativen
Plastik ist allgegenwärtig in unserem Leben, besonders als Einwegprodukt. Dennoch gibt es zahlreiche Möglichkeiten, diesen umweltschädlichen Stoff zu reduzieren. Ein erster wichtiger Schritt ist das Mitbringen eigener Behälter und Taschen beim Einkaufen. Alte Bäckertüten, Stoffbeutel oder wiederverwendbare Netze sind praktische Alternativen zu Einwegtüten. Tatsächlich macht der Plastikmüll im Verpackungsbereich etwa ein Drittel des Kunststoffverbrauchs in Deutschland aus.
Beim Einkauf lohnt es sich, unverpackte Produkte zu bevorzugen. Obst und Gemüse können meist ohne Plastikverpackungen gekauft werden. Darüber hinaus bieten mittlerweile viele Supermärkte Backwaren, teilweise sogar Nudeln und Cerealien ohne Verpackung an. Mehrwegsysteme aus Glas oder langlebigem Kunststoff bieten eine umweltfreundliche Alternative, beispielsweise für Joghurt im Mehrwegglas oder regional abgefüllte Getränke.
Weitere einfache Umstellungen:
- Statt Einwegflaschen: Leitungswasser trinken oder Mehrwegflaschen nutzen
- Anstelle von Duschgel: Feste Seife verwenden (spart zudem Verpackungsmüll)
- Bei Kosmetik: Auf Produkte ohne Mikroplastik achten (zertifizierte Naturkosmetik ist frei von erdölbasierten Bestandteilen)
Stromsparen ohne Komfortverlust
Der Energieverbrauch in privaten Haushalten bietet enormes Einsparpotenzial, ohne dass wir dabei auf Annehmlichkeiten verzichten müssen. Ein häufig übersehener «Stromfresser» ist der Standby-Verbrauch. Geräte, die im Standby-Modus laufen, können in einem typischen Haushalt rund 10% des gesamten Stromverbrauchs ausmachen. Durch den Einsatz von Steckerleisten mit Schalter oder das konsequente Trennen nicht genutzter Geräte vom Stromnetz lässt sich dieser «Phantom-Verbrauch» erheblich reduzieren.
Bei der Beleuchtung bieten LED-Lampen ein hervorragendes Einsparpotenzial. Sie benötigen – bei gleicher Helligkeit – nur etwa ein Fünftel so viel Energie wie herkömmliche Glühlampen. Auch kleine Verhaltensänderungen, wie das Licht beim Verlassen eines Raumes auszuschalten oder Bewegungsmelder in Fluren zu installieren, führen zu messbaren Einsparungen.
In der Küche können allein durch Verhaltensänderungen Stromkosten in Höhe von 93 Euro pro Jahr eingespart werden. Einfache Massnahmen sind:
- Beim Kochen immer einen passenden Deckel verwenden
- Die Restwärme von Backofen und Herdplatten nutzen
- Auf das Vorheizen des Backofens verzichten
- Den Wasserkocher nur mit der benötigten Wassermenge füllen
Beim Kauf neuer Haushaltsgeräte lohnt sich der Blick auf die Energieeffizienzklasse. Die Anschaffung energieeffizienter Geräte rechnet sich, wenn man die Stromkosten über die gesamte Lebensdauer von etwa 15 Jahren berücksichtigt.
Wasser bewusster nutzen
Wasser ist ein kostbares Gut, dessen bewusste Nutzung nicht nur die Umwelt schont, sondern auch den Geldbeutel entlastet. Im Badezimmer, wo durchschnittlich das meiste Wasser verbraucht wird, lässt sich mit einfachen Mitteln eine erhebliche Menge einsparen.
Ein einfacher, aber wirkungsvoller Tipp ist die Installation eines Sparduschkopfes, der den Wasserverbrauch beim Duschen um bis zu 50% reduzieren kann. Auch Durchflussbegrenzer an Wasserhähnen können den Wasserverbrauch beim Händewaschen um bis zu 60% senken – meist ohne spürbaren Komfortverlust.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen tropfende Wasserhähne: Ein einziger tropfender Hahn kann täglich bis zu 45 Liter Trinkwasser verschwenden. Laut einer Berechnung sind es sogar 800 Liter im Jahr, wenn der Hahn alle zwei Sekunden tropft.
Weitere praktische Wasserspartipps:
- Beim Zähneputzen einen Becher statt fliessendes Wasser verwenden
- Obst und Gemüse in einer Schüssel statt unter fliessendem Wasser waschen
- Bei Toilettenspülungen die Wasserstopp-Taste oder kleinere Spültaste nutzen (spart bis zu 50% Wasser)
- Regenwasser zum Giessen von Pflanzen sammeln
Mit diesen ersten Schritten können wir bereits einen beachtlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit im Alltag leisten – und das meiste davon lässt sich ohne grossen Aufwand in unsere tägliche Routine integrieren.
Nachhaltige Ernährung: Gesund für Mensch und Umwelt
Unsere Ernährungsweise hat enorme Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Die Entscheidungen, die wir täglich beim Einkaufen und Kochen treffen, beeinflussen nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch den Zustand unseres Planeten. Tatsächlich trägt die Lebensmittelproduktion weltweit zur Überlastung der planetaren Grenzen bei – in Deutschland sind es sogar 60 Prozent. Doch wie können wir unsere Ernährung nachhaltiger gestalten? Mit ein paar gezielten Änderungen können wir viel bewirken.
Regionale und saisonale Produkte erkennen
Der Kauf regionaler Lebensmittel wird immer beliebter. Laut dem BMEL-Ernährungsreport 2024 legen mehr als drei Viertel der Befragten Wert darauf, dass ein Lebensmittel aus der Region stammt. Die Gründe dafür sind vielfältig: Frische, Unterstützung lokaler Erzeuger und Klimaschutz durch kürzere Transportwege stehen im Vordergrund.
Allerdings ist der Begriff «regional» gesetzlich nicht definiert. Daher wird er von Herstellern und Händlern sehr unterschiedlich interpretiert – eine «Region» kann wenige Kilometer, ein Bundesland oder sogar ganz Deutschland umfassen. Wie erkennt man also tatsächlich regionale Produkte?
Zunächst hilft das «Regionalfenster» als bundesweit einheitliche Kennzeichnung. Es gibt Auskunft über die Herkunft der Hauptzutaten und den Verarbeitungsort. Dennoch definiert jeder Regionalfensternutzer die Region selbst, weshalb ein kritischer Blick wichtig bleibt.
Darüber hinaus können folgende Orientierungshilfen nützlich sein:
- Wochenmärkte und Hofläden bieten häufig Produkte aus der näheren Umgebung an, wobei man nachfragen sollte, da auch dort zugekaufte Waren verkauft werden
- Bei Marktschwärmern oder in Solidarischer Landwirtschaft (SoLaWi) kann man direkt bei regionalen Erzeugern einkaufen
- Bei Obst und Gemüse ist das Ursprungsland auf Schildern oder Verpackungen angegeben
Neben der Regionalität ist die Saisonalität ein wichtiger Faktor für die Nachhaltigkeit. Inzwischen werden über 60 Prozent des Gemüses und 80 Prozent des Obstes nach Deutschland importiert. Dieser hohe Importanteil bedeutet einen enormen Energieaufwand für Transport, Treibhäuser oder Kühlung – mit entsprechenden Auswirkungen auf Klima und Umwelt.
Lebensmittelverschwendung vermeiden
Ein erschreckendes Bild: Jede Sekunde landen in Deutschland 313 Kilogramm essbare Lebensmittel in der Tonne. Insgesamt werden jährlich 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen, wobei mindestens zehn Millionen Tonnen davon gerettet werden könnten. Jeder von uns wirft durchschnittlich 78 Kilogramm Lebensmittel pro Jahr weg.
Doch jeder kann sofort damit beginnen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Praktische Tipps hierfür:
- Vor dem Einkauf planen: Kühlschrank und Vorräte prüfen, Einkaufsliste erstellen und sich daran halten
- Vorratshaltung optimieren: Neue Ware nach hinten, ältere nach vorne stellen
- Mindesthaltbarkeitsdatum richtig verstehen: Es ist kein Wegwerfdatum – viele Produkte sind auch nach Ablauf noch geniessbar
- Sinne einsetzen: Schauen, riechen, schmecken statt blind aufs Datum vertrauen
- Reste kreativ verwerten: Übriggebliebenes einfrieren oder zu neuen Gerichten verarbeiten
Besonders jüngere Menschen werfen tendenziell mehr verwertbare Lebensmittel weg. Hier ist Aufklärung wichtig, denn wer Lebensmittel rettet, schont nicht nur die Umwelt, sondern spart auch Geld.
Pflanzliche Alternativen entdecken
Die Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen zu tierischen Produkten nimmt stetig zu. In der Schweiz beispielsweise geben 30 Prozent der Bevölkerung an, mehrmals pro Monat pflanzliche Alternativen zu Fleisch, Milch und Käse zu geniessen. Die Hauptmotive dafür sind Umweltschutz (53%), Gesundheit (49%) und Tierschutz (46%).
Dieser Trend hat gute Gründe: Pflanzliche Kost verursacht durchschnittlich nur ein Zehntel der Treibhausgase, die bei der Erzeugung von Fleisch und Milchprodukten anfallen. Für eine nachhaltige Ernährung müssten auf unseren Feldern doppelt so viel Obst und Gemüse, deutlich mehr Nüsse und Hülsenfrüchte angebaut und weniger Tiere gehalten werden.
Das Angebot an pflanzlichen Alternativen ist mittlerweile beeindruckend vielfältig. Von Milchersatzprodukten aus Hafer, Soja oder Mandeln über pflanzliche Fleischalternativen wie Tofu, Seitan oder Jackfrucht bis hin zu veganen Süssigkeiten – die Auswahl lädt zum Experimentieren ein.
Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen und Kichererbsen sind dabei besonders wertvoll: Sie liefern wertvolles Protein, sind preiswert und lassen sich vielseitig zubereiten – etwa als Bratlinge oder in «Hacksaucen». Die EAT-Lancet-Kommission empfiehlt für eine gesunde und nachhaltige Ernährung täglich etwa 100 Gramm Hülsenfrüchte und 25 Gramm Nüsse.
Nachhaltigkeit im Alltag umzusetzen bedeutet nicht, komplett auf tierische Produkte zu verzichten. Vielmehr geht es um bewusstere Entscheidungen und ein schrittweises Umdenken. Jeder kleine Schritt zählt und trägt zu einem grösseren Ganzen bei.
Mobilität neu denken: Umweltfreundlich von A nach B
Die Art, wie wir uns fortbewegen, hat einen enormen Einfluss auf unseren ökologischen Fussabdruck. Tatsächlich verursacht der Verkehr rund ein Fünftel der Gesamt-Treibhausgasemissionen in Deutschland. Obwohl sich die Verkehrsleistung seit 1960 mehr als vervierfacht hat, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, unsere Mobilität nachhaltiger zu gestalten – ohne dabei auf Flexibilität zu verzichten.
Alltagswege optimieren
Ein überraschendes Faktum: Ein Drittel aller Strecken, die mit dem Auto zurückgelegt werden, sind unter drei Kilometer lang, die Hälfte sogar unter fünf Kilometer. Entfernungen, für die man mit dem Fahrrad meist nur eine Viertelstunde benötigt. Durch das Ersetzen kurzer Autofahrten können wir nicht nur CO₂ einsparen, sondern gleichzeitig etwas für unsere Gesundheit tun.
Besonders wichtig ist das vorausschauende Fahren bei unvermeidbaren Autofahrten. Hierbei gilt:
- Vermeiden Sie Kurzstrecken mit kaltem Motor, da hier der Verbrauch besonders hoch ist
- Fahren Sie mit gleichbleibenden, moderaten Geschwindigkeiten
- Überprüfen Sie regelmässig den Reifendruck – ein um 0,5 bar zu niedriger Druck erhöht den Kraftstoffverbrauch um fünf Prozent
Darüber hinaus kann das Vermeiden von Verkehr durch veränderte Siedlungs- und Produktionsstrukturen oder eine erhöhte Fahrzeugauslastung zu «mehr Mobilität mit weniger Verkehr» führen.
Alternativen zum eigenen Auto
Durch Luftverschmutzung, Platzverbrauch und Unfälle bürdet jedes Auto der Gesellschaft jährlich Kosten zwischen 4.000 und 5.000 Euro auf. Daher lohnt es sich, Alternativen in Betracht zu ziehen.
Carsharing erfreut sich zunehmender Beliebtheit – in der Schweiz gibt es bereits rund 6.000 geteilte Autos. Diese Modelle sparen nicht nur Anschaffungskosten und Wertverlust, sondern auch Reparaturkosten und Parkgebühren. Besonders interessant: Laut EnergieSchweiz steht ein Auto durchschnittlich 23 Stunden pro Tag still.
Für kürzere Strecken und Transportaufgaben bieten elektrische Lastenräder eine umweltfreundliche Alternative. Diese werden in manchen Bundesländern sogar durch Prämien gefördert oder als Sharing-Modelle angeboten. Auf dem Land, wo oft weniger öffentliche Verkehrsmittel verfügbar sind, können Rufbusse, Mitfahrgelegenheiten oder E-Bikes sinnvolle Alternativen darstellen.
Nachhaltig reisen im Urlaub
Beim Reisen haben wir besonders grosse Hebel für mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Ein Greenpeace-Report aus 2021 zeigt: Ein Drittel der Kurzstreckenflüge innerhalb Europas lassen sich bequem durch Bahnfahrten ersetzen, in weniger als sechs Stunden Fahrzeit. Tatsächlich ist eine Zugfahrt zehnmal so energieeffizient wie ein Flug und verursacht rund fünfmal weniger Treibhausgase.
Dennoch muss die Reise nicht mit Komfortverlust einhergehen. Folgende Alternativen bieten sich an:
Für Fernreisen sind Nachtzüge oder Fernbusse klimafreundliche Optionen. Wer auf das Auto nicht verzichten möchte, kann es mit dem Autozug transportieren lassen oder vor Ort ein Fahrzeug mieten. Besonders umweltschonend ist die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder Fahrräder am Urlaubsort.
Bei Kreuzfahrten ist Vorsicht geboten: Sie gehören zu den umweltschädlichsten Reiseformen, da die Schiffe grosse Mengen Treibhausgase ausstossen und immens viel Strom verbrauchen. Hingegen bieten Segelkreuzfahrten eine umweltfreundlichere Alternative.
Falls ein Flug unvermeidbar ist, kann die Klimabelastung reduziert werden, indem man:
- Direktflüge bevorzugt, da Starts und Landungen besonders viel CO₂ verursachen
- Länger am Urlaubsort bleibt, anstatt mehrere kürzere Reisen zu unternehmen
- Den CO₂-Ausstoss durch Kompensationszahlungen ausgleicht
Mit diesen Massnahmen können wir unsere Mobilität nachhaltiger gestalten und dennoch flexibel bleiben – ein wichtiger Baustein für mehr Nachhaltigkeit im Alltag.
Digitale Nachhaltigkeit: Der übersehene Umweltfaktor
Die digitale Welt verändert unser Leben grundlegend, doch deren Umweltauswirkungen bleiben oft im Verborgenen. Tatsächlich verursacht die Digitalisierung etwa 1,8 bis 3,2 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. Diese Zahl mag zunächst klein erscheinen, jedoch entspricht sie in etwa dem CO2-Fussabdruck des gesamten Flugverkehrs. Unser digitaler Lebensstil hinterlässt deutliche Spuren – und bietet gleichzeitig Chancen für mehr Nachhaltigkeit im Alltag.
Energieverbrauch digitaler Geräte reduzieren
Die Herstellung und Nutzung digitaler Geräte verursacht erhebliche Umweltbelastungen. Besonders bemerkenswert: Etwa 70 Prozent der durch Informations- und Kommunikationstechnologien verursachten Emissionen entstehen durch Endgeräte in Haushalten und Unternehmen. Die graue Energie – also jene, die für Herstellung, Transport und Entsorgung aufgewendet wird – übersteigt bei digitalen Geräten zudem bei weitem den Nutzungsverbrauch.
Für einen Laptop fallen allein bei der Produktion etwa 200 kg CO2-Äquivalente an. Deshalb lautet eine zentrale Empfehlung: Geräte so lange wie möglich nutzen. Der wichtigste Punkt ist, elektronische Geräte nicht mit jeder neuen Generation auszutauschen, denn etwa 80 Prozent der Energie wird beim Rohstoffabbau und bei der Herstellung verbraucht.
Für den täglichen Gebrauch gelten folgende Faustregeln:
- Je grösser, älter und länger im Einsatz ein Gerät ist, desto höher ist der Stromverbrauch
- Über Kabel ins Internet zu gehen verbraucht weniger Ressourcen als WLAN, und WLAN weniger als Mobilfunk
- Beim Musikstreaming nur Audio und nicht Video laufen lassen, wenn man ohnehin nicht zuschaut
- Geräte wirklich ausschalten statt im Standby-Modus zu lassen, denn Geräte im Standby können bis zu 10 Prozent des Stromverbrauchs ausmachen
Darüber hinaus lohnt es sich, die Videoauflösung an die Bildschirmgrösse anzupassen – besonders bei kleinen Bildschirmen spart das viel Energie. Wer von Standard- auf HD-Qualität verzichtet, kann beim Streaming bis zu 95 Prozent Energie einsparen.
Nachhaltige Online-Praktiken entwickeln
Unsere Online-Aktivitäten verursachen überraschend hohe Emissionen. Eine Stunde Surfen auf digitalen Plattformen kann – je nach Berechnungsmethode – bis zu 280 Gramm CO2 verursachen. Ebenso beeindruckend: Streaming macht etwa 80 Prozent des gesamten Internetverkehrs aus.
Für nachhaltigeres Online-Verhalten empfehle ich folgende Praktiken:
Zunächst sollten E-Mails regelmässig aufgeräumt werden, denn jede gespeicherte Mail verbraucht kontinuierlich Strom auf Servern. Eine normale E-Mail verursacht etwa 4 Gramm CO2, mit Anhang sogar bis zu 50 Gramm. Statt grosse Dateien anzuhängen, ist es umweltfreundlicher, einen Link zu verschicken.
Ebenso wichtig ist die Wahl nachhaltiger Web-Dienste. Wer eine Website betreibt, sollte auf einen Hosting-Provider setzen, der erneuerbare Energien nutzt. Dienstleistungen in der Cloud wie OneDrive oder iCloud benötigen wesentlich mehr Energie als lokale Speicherung auf externen Festplatten.
Beim Videostreaming oder Videokonferenzen kann man oft die Kamera ausschalten, wenn sie nicht benötigt wird. Studien zeigen, dass 15 Stunden wöchentliche Meetingzeit mit Video monatlich 9,4 kg CO2 verursachen, mit ausgeschalteter Kamera hingegen nur 377 Gramm.
Grundsätzlich gilt: Die Digitalisierung kann helfen, Ressourcen zu sparen. In der Schweiz beispielsweise liessen sich durch digital optimierte Prozesse jährlich etwa 15 Prozent der inländischen CO2-Emissionen einsparen. Allerdings führen Effizienzgewinne oft zum sogenannten Rebound-Effekt – wir nutzen zwar effizientere Geräte, dafür aber mehr davon und häufiger.
Nachhaltigkeit im digitalen Alltag bedeutet daher, bewusste Entscheidungen zu treffen und digitale Technologien gezielt einzusetzen – beispielsweise wenn durch eine Videokonferenz eine Reise vermieden werden kann.
Ihren Fortschritt messen und verbessern
Um die Wirksamkeit Ihrer nachhaltigeren Lebensweise zu erkennen, ist eine regelmässige Überprüfung Ihres Fortschritts wesentlich. Wie der Bundesrat betont, brauchen wir geeignete Messinstrumente, um zu wissen, wo wir auf dem Weg zur Nachhaltigkeit stehen.
Den eigenen ökologischen Fussabdruck berechnen
Der ökologische Fussabdruck zeigt, wie viele Ressourcen wir durch unsere Lebensweise verbrauchen. In Deutschland liegt dieser Wert bei etwa fünf globalen Hektar (gha) pro Person – während global nur 1,7 gha pro Person nachhaltig wären. Diese Differenz macht den Handlungsbedarf deutlich.
Für die Berechnung gibt es verschiedene Online-Tools:
- Der WWF-Klimarechner analysiert Ihren CO₂-Ausstoss und bietet konkrete Verbesserungstipps
- Brot für die Welt ermittelt Ihren Fussabdruck anhand von 13 Fragen
- Das Global Footprint Network bietet detailliertere Berechnungen
Die Ergebnisse unterscheiden sich je nach Rechner, zeigen aber zuverlässig, ob Ihr Fussabdruck über dem nachhaltigen Niveau liegt.
Persönliche Nachhaltigkeitsziele setzen
Nachdem Sie Ihren Status quo kennengelernt haben, können Sie gezielt Verbesserungsziele definieren. Wichtig ist, sich auf konkrete Bereiche zu konzentrieren, die Sie besonders interessieren oder wo Sie am meisten bewirken können.
Setzen Sie spezifische, messbare Ziele – beispielsweise «Wasserverbrauch um 30% senken» anstatt vager Vorsätze. Dabei hilft die Einteilung in die drei Nachhaltigkeitssäulen (ökologisch, ökonomisch, sozial), um Ihre Ziele strukturiert anzugehen.
Erfolge dokumentieren und feiern
Die kontinuierliche Messung Ihres Fortschritts ist entscheidend für langfristigen Erfolg. Ähnlich wie Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte erstellen, können Sie Ihre persönlichen Fortschritte dokumentieren. Diese Dokumentation ermöglicht es, Ihre Leistung zu messen und den Fortschritt im Bereich Nachhaltigkeit zu verfolgen.
Vergessen Sie nicht, Ihre Erfolge zu feiern! Selbst kleine Veränderungen verdienen Anerkennung, denn sie motivieren zum Weitermachen. Besonders nachhaltig leben übrigens oft Familienunternehmen, die seit Generationen langfristig denken – ein Prinzip, das wir alle übernehmen können.
Denken Sie daran: Nachhaltigkeit ist kein Zustand, sondern ein fortlaufender Prozess. Was eine Wirkung haben soll, muss bewertet werden können – erst dann können Sie Ihre nachhaltige Lebensweise kontinuierlich verbessern.
Schlussfolgerung
Nachhaltigkeit bedeutet nicht, unser Leben radikal umzukrempeln. Vielmehr zeigt dieser Praxis-Guide, dass bereits kleine Veränderungen in unserem Alltag beachtliche Wirkung entfalten können. Die vorgestellten Bereiche – von Ernährung über Mobilität bis hin zur digitalen Nachhaltigkeit – bieten zahlreiche Möglichkeiten für nachhaltigere Entscheidungen.
Besonders wichtig erscheint die Erkenntnis, dass jeder einzelne Schritt zählt. Ob Plastikvermeidung, bewusster Wasserverbrauch oder nachhaltige Mobilität – alle diese Massnahmen tragen zum grossen Ganzen bei. Dabei hilft uns die regelmässige Überprüfung unseres ökologischen Fussabdrucks, unseren Fortschritt messbar zu machen und stetig zu verbessern.
Die Zeit drängt, denn unser aktueller Ressourcenverbrauch übersteigt die Kapazitäten unseres Planeten deutlich. Dennoch stimmt optimistisch, dass immer mehr Menschen bereit sind, ihren Lebensstil nachhaltiger zu gestalten. Gemeinsam können wir durch bewusste Entscheidungen im Alltag den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen.

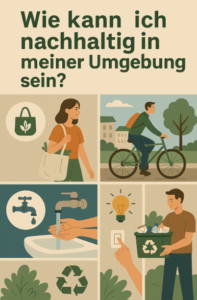

Schreiben Sie einen Kommentar